Aktuelle F&E-Projekte
Für Geo5 GmbH ist Forschung und Entwicklung (F&E) traditionell eines der wichtigsten Eckpfeiler des Unternehmens. Zirka ein Drittel der Mitarbeiter von Geo5 GmbH ist in der F&E Abteilung beschäftigt. Diese sind für das Unternehmen von unschätzbarem Wert. Mit Hilfe der hohen F&E Quote kann die hohe Innovationskraft des Unternehmens gehalten und immer wieder verbessert werden und neue Produkte bzw. Software entwickelt werden.
ATESref
Aquifer Thermal Energy Storage und Reinjektion am Beispiel Fürstenfeld
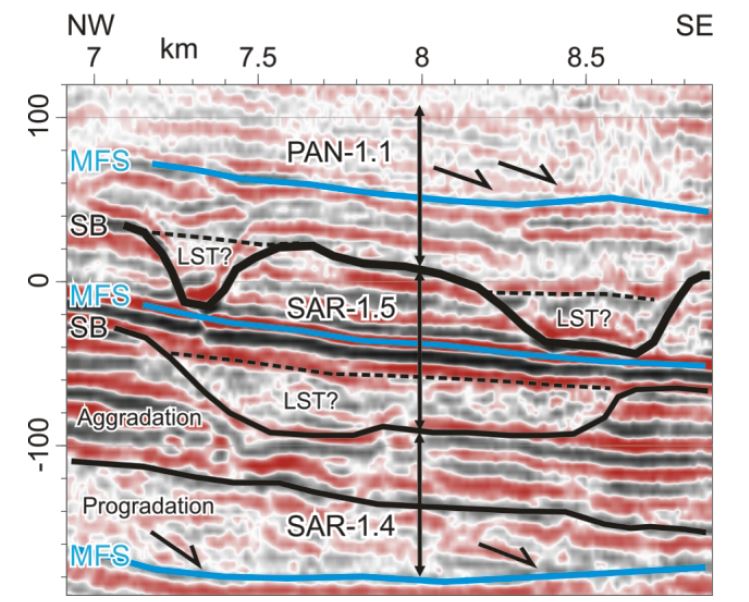
Die saisonale Großwärmespeicherung mit Aquiferspeicher (ATES) stellt einen zukunftsträchtigen Ansatz dar, um erneuerbare Energiequellen effizient zu nutzen und Energieüberflüsse aus beispielsweise Sonnen-, Biomasse-, Geothermie- oder Windenergie zu speichern. Dieser Ansatz trägt maßgeblich zur Umsetzung der Forschungs-, Technologie- und Innovations-Roadmap-Geothermie (FTI-Roadmap) für die Energiewende bei, indem der ATES eine zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie über das ganze Jahr hinweg ermöglicht. Dabei ist ein zentraler Schritt die Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen, um zum einen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber auch die Unabhängigkeit von Lieferengpässen, wie es in den kürzlichen Krisenzeiten der Fall war, sollen damit entgegengewirkt werden.
Um saubere Energiequellen aus Erneuerbaren nun ganzjährig mit ATES nutzbar zu machen sind noch weitere Forschungs- und Entwicklungsschritte notwendig um in Österreich den ersten ATES in Betrieb nehmen zu können. Das hier vorgestellte Projekt behandelt daher noch wichtige offene Forschungsfragen für die Integration von ATES in Österreich mit einem repräsentativen Beispiel im steirischen Becken am Standort Fürstenfeld. Aufbauend auf einer geologischen Recherche und einer Neubearbeitung von bestehenden Seismikprofilen sollen die Tiefe, Mächtigkeit und räumliche Ausbreitung bekannter potentieller Speicherhorizonte wie z.B. des Carinthischen Schotters aus dem Sarmatium (Tiefe ca. 650 m unter GOK) und noch nicht identifizierten Speicherhorizonten im Raum Fürstenfeld bestimmt werden. Durch die Weiterentwicklung der Methodik können weitere geeignete Standorte in Österreich für Geothermieanlagen identifiziert werden. Ein weiterer Schritt im Projekt ist die numerische Modellierung des ATES bzw. die Konzeptentwicklung für die Systemintegration im naheliegenden Wärmenetz, wobei auch weitere Integrationskonzepte für die Transferability der Technologie beleuchtet werden. Weitere Problematiken hinsichtlich der Reinjektion in Locker- und Festsedimenten oder hydrogeochemische Fragestellungen sollen beantwortet und auf andere Standorte mit ähnlichen geologischen Verhältnissen übertragen werden. Abgerundet wird das Projekt mit einer rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Evaluierung, um die ATES Integration voranzutreiben und weitere Schritte Richtung Klimaneutralität in Österreich zu setzen. Für den Erfolg dieses Projektes wurde ein schlagkräftiges Konsortium entlang der Wertschöpfungskette aufgestellt.
Fossilfree4Industry
Nachhaltige Energieversorgung

Auf nationaler (BMK-Wärmestrategie) und auf EU-Ebene (Kommission) besteht Konsens darüber, dass Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energie verstärkt forciert werden müssen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die drei Hauptsektoren an Verbrauchern (Industrie, Wohnen und Mobilität) zu dekarbonisieren. Neben globalen Ansätzen zur Erreichung einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft wird es notwendig sein, verstärkt einen regional ausgerichteten Ansatz zur Verwirklichung dieser transformativen Ziele zu verfolgen.
Die vollständige Dekarbonisierung der Industrie stellt besondere Herausforderungen an alle beteiligten Stakeholder. Betriebe sind gefordert, ihre Energieversorgung durch hohe Energie- und Ressourceneffizienz und die Integration erneuerbarer Energie komplett unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen (derzeit 30 % der österreichischen Treibhausgasemissionen und etwa 1/3 des Gesamtenergieverbrauch). Dabei gilt es einerseits konsequent eigene Potenziale (Abwärmen, Reststoffe und Erneuerbare vor Ort) zu nutzen und andererseits übergeordnete erneuerbare Konversionsanlagen und Verteilstrukturen aufzubauen. Hinzu kommt, dass für bestimmte Industriesektoren und dort angesiedelte Produktionsprozesse zukünftig auch nach prozesstechnischer Optimierung erheblicher Bedarf für Wärmeversorgung auf höherem Temperaturniveau vorhanden sein wird. Das bedingt, dass Energiesysteme von derzeit monovalenter Versorgung (1 Energieträger, 1 Kessel, 1 Temperaturniveau) zu hybriden Systemen transformiert werden müssen, die mehrere Energieträger nutzen und unterschiedliche Temperaturniveaus und betriebliche Versorgungsmedien (Heißwasser, Dampf, Thermoöl, etc.) bereitstellen. Die Ressourcen für diese zukünftige Versorgung müssen nun in gezielter Kombination aus vor Ort und im Umfeld bzw. der Region nutzbaren Potenzialen kommen. Neben der Steigerung der Ressourceneffizienz müssen verstärkt regionale Energiequellen, Abwärmen und Reststoffströme genutzt werden sowie Energiesektoren gekoppelt werden, damit mit den verfügbaren erneuerbaren Potenzialen das Auslangen gefunden werden kann. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass für die zukünftige Versorgung von vielen Prozessen weiterhin hohe Temperaturen benötigt werden wird und deshalb ein Ersatz für fossiles Gas gefunden werden muss.
Das produzierende Gewerbe und die Industrie ist mit mehr als 700.000 Beschäftigten für die österreichische Wertschöpfung (Anteil 18 %) als Wirtschaftszweig von zentraler Bedeutung. Die vollständige Dekarbonisierung stellt jedoch besondere Herausforderungen an alle beteiligten Akteure. Der Wirtschaftsstandort, mit 35,3 % Erwerbstätigen im Sekundärsektor (Bundesland Steiermark: 26,8 %), ist abhängig vom Produktionsfaktor Energie und dessen Preis- und Versorgungsicherheit. Somit ist es von zentraler Wichtigkeit, mit konkreten Maßnahmen den raschen Ausstieg (Phase Out) aus der fossilen Gasversorgung zu realisieren und dadurch ein selbstbestimmtes Energieversorgungssystem aufzubauen sowie den jährlichen Wertschöpfungsabfluss der Region durch Energieimporte von rund 200 Mio Euro umzukehren
Die Region WEIZplus besteht aus 41 zusammenhängenden Gemeinden, wovon alle Gemeinden in sieben Klima- und Energie-Modellregionen integriert sind. Der Energieverbrauch, mit ca. 120 000 Einwohner*innen und einer Vielzahl von Industrie- und Gewerbebetrieben (rund 5.000 Betriebe, davon mehr als 100 Industrieunternehmen), liegt bei rund 3,9 TWh wovon aktuell 35 % aus erneuerbaren Ressourcen stammen.
Das Reallabor WEIZplus ist für die Entwicklung eines integrierten, regionalen Energiesystems prädestiniert, da es durch seine Diversität auf viele andere Regionen in Österreich replizierbar erscheint - vom Almenland, über dünn besiedelte Landgemeinden mit hohem Anteil an Land- und Forstwirtschaft und Tourismus bis zu Regionen mit urbanem Charakter sowie starken und wachsenden Industrie- und Gewerbeansiedelungen. Damit verbunden sind regionsspezifische Herausforderungen und Fragestellungen in Bezug auf die zu untersuchenden Sektoren der Energieanwendung (Strom, Wärme, Mobilität). Das Leitprojekt "Fossilfree4Industry" widmet sich dem Ausstieg der zahlreichen Industrie- und Gewerbebetriebe aus fossilen Energieträgern (größtenteils Erdgas) für die Prozess- und Raumwärmeversorgung im Umfeld der Städteachse Weiz und Gleisdorf und kann als Good Practice Modell mit hohem Multiplikationspotential für zukünftige Lösungselemente, Prozesse und Methoden gesehen werden.
Cells4Energy
Ausgangssituation und Erfordernisse

Die Energiewende ist ein umfassendes Infrastrukturprojekt und ein massives Digitalisierungsvorhaben. Die sozialen und ökonomischen Implikationen erfordern einen multi- und interdisziplinären Zugang. Der Umbau unseres Energiesystems erfordert ein Zusammenwirken aller beteiligten Stakeholder und den politischen Willen, die komplexen Hürden gemeinsam zu bewältigen. Energiewende ist keine Kurskorrektur, sondern in vielen Bereichen eine völlige Neugestaltung von Technologien, Gewohnheiten und Geschäftsprozessen.
Zusammenfassend, erfordert die Energiewende einen Paradigmenwechsel in der gesamten Energieversorgung. Aus den folgenden Schemata gilt es auszubrechen:
- Energiefluss vom Zentrum zur Peripherie => soll übergeführt werden in dezentrale Energieerzeugung
- Erzeugung folgt Last => soll übergeführt werden in beidseitigen Ausgleich
- Getrennte Betrachtung der Sektoren => soll übergeführt werden in umfassende Sektorkopplung
Aus der Volatilität und der geographischen Verteilung erneuerbarer Erzeugung folgt eine signifikante Mehrbelastung für die elektrische Netzinfrastruktur auf allen Spannungsebenen. Dadurch steigt der Bedarf an Speichertechnologien bzw. anderen Flexibilitätsoptionen. Dies wird neben dem eigentlichen Ausbau als eine der kritischsten Herausforderungen angesehen, um die geplanten Ziele für 2030 bzw. 2040 (Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten Österreich: 'Klimaneutral bis 2040: Außenministerium stärkt Standort Österreich und Klimaschutz durch grüne Wirtschaftsdiplomatie', Wien, 2021) zu erreichen. Investitionen in belastbarere und flexiblere Netze sind genauso wesentlich wie Optimierung und Integration von verbraucherseitigen Flexibilitäten und Schaffung eines adäquaten regulatorischen Rahmens, um die Einbindung von Konsument:innen zu fördern.
Der stabile Betrieb des Stromnetzes besteht im Wesentlichen darin, ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Stromangebot und Stromverbrauch unter den physikalischen Beschränkungen des Übertragungs- und Verteilungsnetzes herzustellen. Der Echtzeitbetrieb zukünftiger Energiesysteme wird sich daher aus "vertikaler Integration", also einer verbesserten Echtzeit Kommunikation zwischen Übertragungsnetzbetreibern (TSOs)/Strommärkten sowie den von regionalen Steuerungssystemen der Verteilnetzbetreiber (DSOs), sowie durch "horizontale Integration" verteilter Steuerungssysteme zusammensetzen. Diese Integration hat sich als technisch und regulatorisch sehr herausfordernd herausgestellt, sowohl durch den benötigen hohen Austausch an Echtzeitinformationen als auch die Herausforderung bei der Ausgestaltung von kurzfristigen Flexibilitätsmärkten, durch die Lokalität der benötigen Flexibilität im Netz (z.B. Gaming, TSO-DSO Interaktion, etc.).
Lösungsansatz
Das Projekt "Cells4Energy" propagiert einen Zellansatz als Lösung. Österreich ist bereits sehr weit bei der Ausgestaltung von Energiegemeinschaften. "Cells4Energy" entwickelt daraus sektorenübergreifende, systemdienstleistungserbringenden Energiezellen in technischer, regulatorischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Dimension.
Die Energiezelle umfasst ein regionales, multi-Sektoren Energiesystem mit interner erneuerbarer Erzeugung, flexibler Last, Importen und Exporten, in dessen Zentrum ein virtuelles Kraftwerk das sektorengekoppelte Energiemanagement leistet. Investition, Kommittent, individuelle Verhaltensänderung und organisatorische Regelungen werden in der Energiezelle auf beherrschbare Komplexität heruntergebrochen, optimiert und Energieströme auf regionaler Ebene ausgeglichen. Die Zellen koordinieren Energiespeicherung und Wandlung in andere Energievektoren ebenso wie Austausch mit anderen Energiezellen.